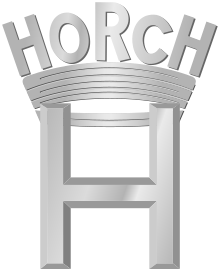Lonja
Ein langer, langer Blog über Lonja Stehelin-Holzing, geborene Helene Freiin von Holzing-Berstett
Mit einem langen Zitat aus dem Sankt-Anna-Platz
Dachte schon,
Lieber Fritz Jörn, ich hatte mir
schon mehr zugetraut, nachdem acht Monate vergangen sind, da ich Abschied nehmen
mußte, von einer außergewöhnlichen Frau, von meiner Frau, und von einem
Stückchen Welt, das mit ihr ging.
Ich brachte Lonja ins Gespräch - sie
ist fast so lange tot wie Britting – und damit eine Frau, die nicht als
irgendwer in einen Blog gehört. Es war eine Frau, die man nicht »nicht lieben«
konnte, eine Zauberin, ein Geist aus vergangener Zeit mit dem staubigen Charme
des Adels, mit dem geistigen Niveau der Antike, mit dem erotischen Reiz der
Verschleierten, dabei aber verspielt, versponnen, modern – und eine Lyrikerin
vom Rang einer Sappho.
Genug, es reicht das eh nicht aus,
um wiederzugeben was sie war. Sie liebte meine Frau, nannte sie Melusine und
Binsenkraut, schüttete ihr Herz bei ihr aus (was übrigens fast alle der vielen
Freundinnen bei meiner Frau taten, war sie doch eine, die zuhören und
mitempfinden konnte).
Britting war mit von der Vring eng
befreundet, die Ehepaare trafen sich in Münchner Weinlokalen. An einem solcher
Abende war es auch meine Frau, die vorschlug, der Sonja [Schuldt verschreibt sich immer wieder von Lonja zu Sonja. fj] einen Preis der
Akademie der schönen Künste zu verleihen, um der Soja finanziell ein wenig zu
helfen, konnte sie doch mit Geld nicht umgehn. Sie bekam den Preis und
verschenkte wahrscheinlich alles an Zigeuner, die sie in ihr Herz geschlossen
hatte. – Die Freiheit, das Vitale, das Geordnete in andere Weise als in unser
Welt.
Ach, was geht mit dem Tod eines
Menschen alles verloren. Lesen Sie das Gedicht vom chinesischen Maler: »So gehen sie in ihre Werke
ein.« [steht hier ganz unten], Zigeunerbraten (Tomate und Igel) von Britting, Gedankenfetzen.
Lesen Sie – und das ist, was mich
emotional sehr bewegt – was meine Frau in ihrem Buch »Sankt-Anna-Platz 10« über
Lonja schreibt [weiter unten] und damit die Schatzkammern meiner Erinnerungen öffnet, die preiszugeben mir unendlich schwer fällt. »So gehen sie in ihre Werke ein«, es ist
also nichts verloren, man muss es nur neu entdecken, über Brücken gehn, durch
Täler und durch Schluchten, muss Berge erklimmen und Nachtigallen singen hören,
schlafen, träumen und wachen, um neu zu sehen, wie unvergleichlich schön das
Leben ist. Wir haben es verlernt!
Wenn ich so weiter schreibe, wird es
ein Buch, das keiner liest! Drum Bloggen? Ist’s am End nicht nur Eitelkeit?
Könnt ja sein, das ein Harfenton ein Ohr erreicht. Wahrscheinlichkeitsrechnung,
Pascal, gefressen wird Laberkas. Aber, c’ est bon, ich versuch es mal
mit einem Lonjablog – wenn Sie mögen.
Ihr alter Hans-Joachim
Schuldt
Ach ja, wir sind bald wieder
Weltmeister im Ball- und Schienenbeintreten! Soll ich darüber mal bloggen?
Doch jedenfalls geht nun zum
Federball (jedoch nicht ohne herzlichen Gruß),
Ihr Hans-Joachim
Schuldt.
[Schreibt dazu der Jörn: Ei freilich ist Bloggen Eitelkeit! Siehe denn auch www.Joern.De/Blog. Tun’S mir bloß nicht auch noch über Fußball herumbloggen !–]
Lieber Herr Jörn,
ich habe Ihnen gestern noch geschrieben und die Briefe der Sonja beigefügt,
finde aber die E-Mail nicht mehr, nur eine Eingangsbestätigung. Haben Sie sie erhalten? [Ja, gleich vier Mal …, also keine Unruhe! Unten ist ein langer Auszug aus dem Brief, schon von Ingeborg in den Sankt-Anna-Platz abgeschrieben. fj]
Nachfolgend nun ein
Beitrag zu Lonja, wie ich ihn sehr gerne hätte, wenn es denn möglich
ist.
Morgen kommt der
Ihnen bekannte Dr. S… und holt den ganzen »Krempel« ab [den Britting-Nachlass].
Nun bleibe nur
noch ich übrig; vielleicht so wie im letzten Gedicht.
Ihr Hans-Joachim
Schuldt
dem’s nicht leichtfällt, wohl wissend, dass es sich ja nur um materielle Güter handelt.
Abschiednehmen hat meine Generation gelernt. Abschied
von Menschen und Dingen, Abschied von Zeitperioden unterschiedlichster Art.
Morgen nun nehme ich Abschied vom literarischen Nachlass meiner Frau. Alles
liegt aufgestapelt bereit, bei einem letzten Blick in eine Schachtel sind es
sechs handgeschriebene Briefe an sie aus den sechziger Jahren, also denen des
Todes von Britting. Ich lese als Anschrift »Liebe Melusine!«, als Absender »Lonja«. Es ist jene Lonja Stehelin-Holzing, die meine Frau in ihrem Buch »Sankt-Anna-Platz 10 – Erinnerungen an Georg
Britting und seinen Münchner Freundeskreis« im Kapitel »Das Leopold« auf den
Seiten 256 bis 260 wie folgt beschreibt [siehe auch www.Britting.De/prosa/anapl.html]:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Es muß noch vor diesem Geburtstag [Brittings 70.ten]
gewesen sein, daß Georg von der Vring eine uns allen Unbekannte an den Tisch
brachte, eine Dame mit großen dunklen Augen und wohllautender Stimme, der man
die einstige Schönheit noch ansah: Lonja Stehelin-Holzing. Vring hielt sie für
eine Lyrikerin, die, im Schatten ihrer berühmten jüngeren Schwester Marie-Luise
Kaschnitz stehend, mit ihrem Talent nicht die Geltung erlangt hatte, die ihr
gebührte. Nicht nur ihrer eigenen Gedichte wegen, die thematisch vielseitig
waren, Sphärenhaftes ebenso ausdrücken konnten wie sie den Volksliedton trafen,
der Vring ansprach:
Die alten Dächer sind
Schön wie Natur.
Dort läßt ein
Hauch von Wind
Schon seine Spur.
Zwischen den Ziegeln bunt
Siedelt das
Moos sich an,
Storchschnabel Steinbrech und
Gräser und
Thymian.
Sie war auch als Übersetzerin englischer Lyrik
hervorgetreten, wie er, Vring selbst, mit seinem Band »Englisch Horn«. Ihre
Übertragung des Dunkirk Pier fand er meisterhaft:
Über die Wogen unserer Finsternis
Schleicht Furcht wie ein schweigender
Oktopus
Fühlend und tastend sich vor. So klar
Wie ein gespiegelter Stern; bebend und kalt wie ein
Vogel;
Und sagt uns Schmerz, und sagt uns Tod sei
nah
beginnt die Ballade von Captain Alan Rook bei
ihr. [Mehr dazu unten. fj]
Auf Vrings Empfehlung hin (unterstützt von Britting und
anderen Mitgliedern) bekam sie 1962 einen Preis der Bayerischen Akademie der
Schönen Künste zugesprochen. Lonja, wie sie genannt wurde, wenn man über sie
sprach, hatte schwierige Lebensverhältnisse hinter sich, über die sie aber nur
andeutungsweise redete, die ein Grund sein konnten für den vernachlässigten
Umgang mit ihren reichen, schöpferischen Gaben. Sie war mit dem Schweizer
Ingenieur Jacques Stehelin verheiratet gewesen, hatte kurze Zeit mit ihm in
Japan gelebt, war von ihm geschieden, hatte zwei Töchter — eine davon, die
»schwarze Anne«, arbeitete kurze Zeit als Sekretärin der Akademie.
Nun saß sie also mit uns am Tisch, manchmal ein wenig
müde, mehr zuhörend, Scherzen zugänglich; oder sie berichtete uns von ihrer
Tätigkeit an der nach dem Krieg eingerichteten Dienststelle für der Ausrottung
entgangene Zigeunerkinder, deren Betreuung ihr jahrelang oblag, bis ein
Stichwort fiel, die Zeile eines Gedichtes an ihr Ohr gelangte, sie das Gedicht
zu Ende zitierte, ein zweites, drittes dazukam, denn »durch diese schöne,
leidenschaftliche und ungebärdige Frau flutete die Lyrik aller Zeiten
unseres Volkes wie das eigene Blut« (so Benno Reifenberg in seinem Nachruf).
Weshalb es sie nach München gezogen hatte, wußten wir
nicht, man fragte auch nicht danach, aber daß sie wenig Geld besaß, in einem
möblierten Zimmer (oder Apartment) wohnte, kam uns schon zu Ohren. Der Satz
eines Briefes, den sie mir 1963 aus Bollschweil schrieb [also Lonja Stehelin-Holzing an Ingeborg Britting]:
»Als ich, um eigentlich zur Besinnung zu kommen, nach
München kam, und dort von Euch schön empfangen und erhalten wurde [...]«, deutet
den Grund wohl an, aber ihr seelischer Haushalt kam auch in München nicht in
Ordnung. Über Marie-Luise Kaschnitz erinnere ich mich nicht, sie sprechen
gehört zu haben, öfter aber über ihren Vater und ihre ältere Schwester Karola,
in der Familie Mary genannt, die sie geliebt und deren Klugheit und
schriftstellerische Gaben sie bewundert hatte. Karola war in erster Ehe mit
Freiherr Marschall von Bieberstein verheiratet gewesen, in zweiter Ehe mit dem
englischen Diplomaten Sir Douglas O’Neill, und sie starb in der Zeit, als Lonja
ihre Flucht nach München antrat, 1960. Wenn man allein mit Lonja war, fiel
einem die tiefe Unruhe auf, die von ihr ausging, eine Ziellosigkeit, und doch war sie auf
der Suche nach Menschen, das spürte man, spürte auch ich, und fürchtete ein
wenig ihre starke Zuwendung, die mir galt, und die Britting in dem Maß nicht
schätzte. Ein Bild bleibt mir unvergeßlich: Lonja in einem himbeerroten,
plissierten, ärmellosen Kleid, zeitlos schön! Sie trug es bei einer
Geburtstagsfeier, zu der ich sie mit uns jüngeren Leuten (ohne Ehemänner),
Schauspielern, Freunden, gebeten hatte und auf der sie, sprühend lebendig, den
Mittelpunkt des Abends bildete.
Es war Parsi (später Percy) Adlon*, der sie zu
nächtlicher Stunde nachhaus begleiten durfte und mir am anderen Morgen am
Telefon von seiner Bewunderung für diese Zauberfrau sprach.
* Percy Adlon, der Filmregisseur, u.a. [Out of Rosenheim]
begann seine Karriere an der Literaturabteilung des Bayerischen Rundfunks als
Sprecher vor allem von Lyrik, er konnte Gedichte vollendet gut lesen.
Wir konnten damals nicht ahnen, daß München und unser
Kreis [um Georg Broitting] ihre [Lonjas] vorletzte Lebensstation sein sollte, bevor sie im Herbst 1964, ein
halbes Jahr nach Brittings Tod, einem Gehirntumor erlag. Wie Marie-Luise
Kaschnitz, für die das Schwarzwald-Dorf Bollschweil und sein Gutshaus Heimat
schlechthin bedeutete, hing auch Lonja an diesem Stück Erde. Ihre Vorfahren
kamen väterlicher- und mütterlicherseits alle aus Baden, aus alten adeligen
Offiziersfamilien. Der Vater, zu dem die Bindung besonders innig war, war
preußischer Generalmajor gewesen, Ordonanzoffizier des Prinzen Max von Baden,
daher lebte die Familie eine Zeit lang in Potsdam, war aber nach 1918 wieder
nach Bollschweil zurückgekehrt.
Im März 1963 hielt sie sich für einige Wochen dort auf,
der Bruder bewirtschaftete jetzt das Gut, und sie erinnerte sich ihrer fast
zwanzig Jahre zurückliegenden Heimkehr von Basel ins Vaterhaus:
»Als ich 1946 wiederkam, habe ich gemeint, jeder
Birkenzweig, jedes knisternde Büschelchen Heidekraut, ja die ganze Landschaft
spüre, daß einer wieder da sei, der sie liebt. Vielleicht war es auch so«,
schrieb sie mir [immer noch Lonja an Ingeborg], und fuhr – wieder zur Gegenwart kommend – fort: »Dies war nun
eine stumme Zeit, draußen und drinnen. Da ich aber heute sowohl ein Rotkehlchen
sah, als auch einen Buntfinken, muß ich Ihnen das melden, mit den liebsten
Grüßen und Frühjahrswünschen für Sie beide, die ich vermisse. Alles ist nur so
reich wie der Mensch selber; (doch wie André Gide muß ich von mir sagen, daß es
mir außerordentlich schwer fällt, unglücklich zu sein(!).
Es kamen aus dem Welschland zarte, brüchige Sesselchen
Louis XVI; Silbertablettchen; eine blaue (jenes herrliche
Blau) Theebüchse; ein Koffer voll Bücher; [....] ein altes
Kornmädchen [Kommödchen! fj]; ein elfenbeinernes Papiermesserchen etc, alle diese Dinge habe ich
in der Grande Maison in Chexbres lebendig gesehen, als Irene Forbes Mosse, die
Enkelin der Bettina, dort lebte. [Ich war damals gegen Kriegsende …] Es war ein wunderbares Haus, eine alte
Landvogtei. Jetzt ist es leer, ist ausgeräumt, alle die dort lebten und ein- und
ausgingen, sind längst zerstreut oder tot […] – was alles so sein muß und in Ordnung
ist! Nur die blaßgrünbespannten Sesselchen, das Récamiercanapee, die Bücher,
die Theebüchse standen all ihres Glanzes, ihres holden Schimmers beraubt,
heimatlos, zusammengefallen, schäbig auf dem grossen Speicher (vom Haus hier) – es waren garnicht dieselben Dinge mehr – ich habe ihre Idee zu eigen, und will
sie nicht, ich werde glücklich sein, wenn meine schwarze Anne sich damit
einrichtet.«
Fünf Jahre nach ihrem Tod kam im Claassen Verlag ein
Bändchen mit Gedichten von Lonja Stehelin-Holzing heraus, das Vorwort schrieb
Benno Reifenberg, das Nachwort Marie-Luise Kaschnitz. Sein Titel: »Das Lied,
eine Flamme«.
Heute werden die drei Schwestern von Holzing-Berstett
manchesmal mit den berühmten Schwestern Brontë verglichen, die aus einem
Pfarrhaus in Yorkshire stammten, Charlotte, Emily und Anne, und alle drei
dichteten. Die bedeutendste der drei war Emily, deren Roman »Wuthering Heights«
zur Weltliteratur zählt.
Das Andenken an Lonja Stehelin-Holzing wird die Mainzer
Akademie* bewahren, die zum 100. Geburtstag der Dichterin eine Publikation über
sie vorbereitet.
* Akademie der Wissenschaften und der Literatur zu
Mainz
_____________________________________________
Abschied nehm ich [Schuldt] nun von diesen Briefen und unzähligen
Schätzen, die sich angesammelt haben in einem so reichen Leben, wie sie es
hatte, Abschied auch von einer Epoche, wie sie jene zauberhafte
Lonja beschrieb. Es fällt mir wieder der Vers von Lonja [aus der Übertragung des
Dunkirk Pier (Pier von Dünkirchen) von
Alan Rook]
ein:
Über die Wogen unserer Finsternis
Schleicht Furcht wie ein schweigender Oktopus
Fühlend und tastend sich vor. So klar
Wie ein gespiegelter Stern; bebend und kalt wie ein Vogel;
Und sagt uns Schmerz, und sagt uns Tod sei nah.
Adieu
[Im Original
hier:]
Deeply across the waves of our darkness fear
like the silent octopus
feeling, groping, clear
as a star’s reflection, nervous and cold as a
bird,
tells us that pain, tells us that death is near.
ALTERSFREUNDE
Sie gehen fort, ganz ohne
Aufsehn,
fast wie wenn sie nur auf dem
Spaziergang abends
statt umzukehren, immer weiter
dort gewandert wären,
wo ihre Augen täglich sich
erfrischten
an Wasser, Grün und
Luft,
und an der Ferne über’m Rand der
Stadt.
Beinahe wie der chinesische
Maler,
der vor Zeiten still in sein
letztes Bild gewandert ist:
Ein Landschaftsbild, vom Kaiser
aufgetragen
für eine Wand im
Sommerpavillon:
Er brauchte lang dafür und wollte
nicht,
daß jemand ihn bei seiner Arbeit
sähe.
Als er dann melden ließ, nun sei
er fertig
und gleich der Kaiser kam, das
Bild beschaun,
da war der Meister fort – war
nirgends!
Aber endlich fand ihn der Kaiser
doch.
Er sah ihn nämlich still,
unaufhaltsam fort
in den gemalten blauen Hügeln
gehn,
an Wassern, über Brückchen,
zwischen Bäumen
und immer ferner, immer zarter
werden,
bis er dann in der Tiefe ganz
entschwand -
ihm, der hier zwischen Trauer und
Entzücken
zurückgelassen noch im Saale
stand.
So gehen sie in ihre Werke
ein.
Lonja Stehelin-Holzing
Durchsichtige Tore.
Hör, es giebt geschwungne Schmiedetore,
und giebt schwere, mit den harten Bohlen,
aus gestrichner Eiche und Beschlägen,
die in einem Eisenkleeblatt enden;
Flügeltüren in gewölbter Einfahrt;
Riegeltüren schräg zu Kellerstufen
in den dunklen Duft von Stein und Wein;
halbe Türen, die im Sommer oben
immer offen sind, so daß ein Bildchen
in den Ställen ist, und in der Scheuer,
frisch, in warmer, friedvoller Heuluft;
endlich glatte weisse, graue Türen
in den Städten, ohne eigne Stimmen –
Aber alle, alle sind wie gläsern,
sind wie Wasser fliessend vor den Blicken, –
Wenn man steht und wartet, daß sie aufgehn,
und schon weiss, was innen ist, von früher,
und von früher weiss: Da ist es schön.
Lonja Stehelin-Holzing, aus dem Brief vom 31. März 1963 an Ingeborg Britting.
Ihre Handschrift, »Schönschrift«-Sorte
Lonja bei Amazon
»Zeit«-Artikel vom 15. 4. 1999 »Bogen der Sehnsucht gespannt«
––––––––––––––––––––––––––––
Hier kamen noch Nachgedanken (und ich hoffentlich nicht in Teufels Küche, wenn ich sie und die Zitate hier bringe. Proteste (und Huldigungen) bitte vertrauensvoll direkt an mich, Fritz@Joern.De; ich fix’s dann – fj).

Lieber Herr Schuldt! Abschied nehmen fällt immer schwer, auch wenn Sie die
schöne Gewissheit haben, der Nachlass Ihrer lieben Frau geht in gute und sichere
und, wie es heute heißt, »kompetente« Hände über (nicht, daß die Ihren nicht
kompetent wären!).
Besonders berührt haben mich die Zeilen über »Lonja«. Sie
gehört zu meinen liebsten Dichtern und gar ihre »Altersfreunde« sind mir engste
Wegbegleiter!
Im letzten Gedichtband von Reiner Kunze fand ich das Gedicht »Fahrt mit altem Meister«. Ich konnte es nicht lassen, dem Dichter die Verse der
Kaschnitz-Schwester zu schicken mit dem Hinweis auf die Verwandtschaft zu seinem
Gedicht. Daraufhin schrieb mir Kunze ein paar sehr liebe Zeilen und schrieb sein
Gedicht extra für mich ab! [Für Walther Prokop] Da war ich platt ...
Ich bin auch ein passionierter Kaschnitz-Leser und, als
wir im Kaiserstuhl Urlaub machten (2001), da besuchten wir natürlich auch
Bollschweil und dann auch Staufen, um die Gräber von
Peter Huchel und
Erhart Kästner
zu besuchen. (Das taten auch Ingeborg
Schuldt-Britting und Hans-Joachim Schuldt.)
– Link zum Band »Fahrt mit altem Meister« hier.
Den Text des Gedichtes mag ich nicht abtippen, dafür ist mir
Kunze noch nicht lang genug tot, ist überhaupt nicht tot, und damit meine ich nicht Unsterblichkeit. Und wenn ich schon beim Reden bin, ich, der »Editor« im Hintergrunde, so find’ ich schade, dass Lonja immer nur als Kaschnitz-Schwester vermarktet wird, wenn überhaupt. Und dass noch wer den Erhart Kästner kennt, meine Jugendlektüre! Tempi passati. fj